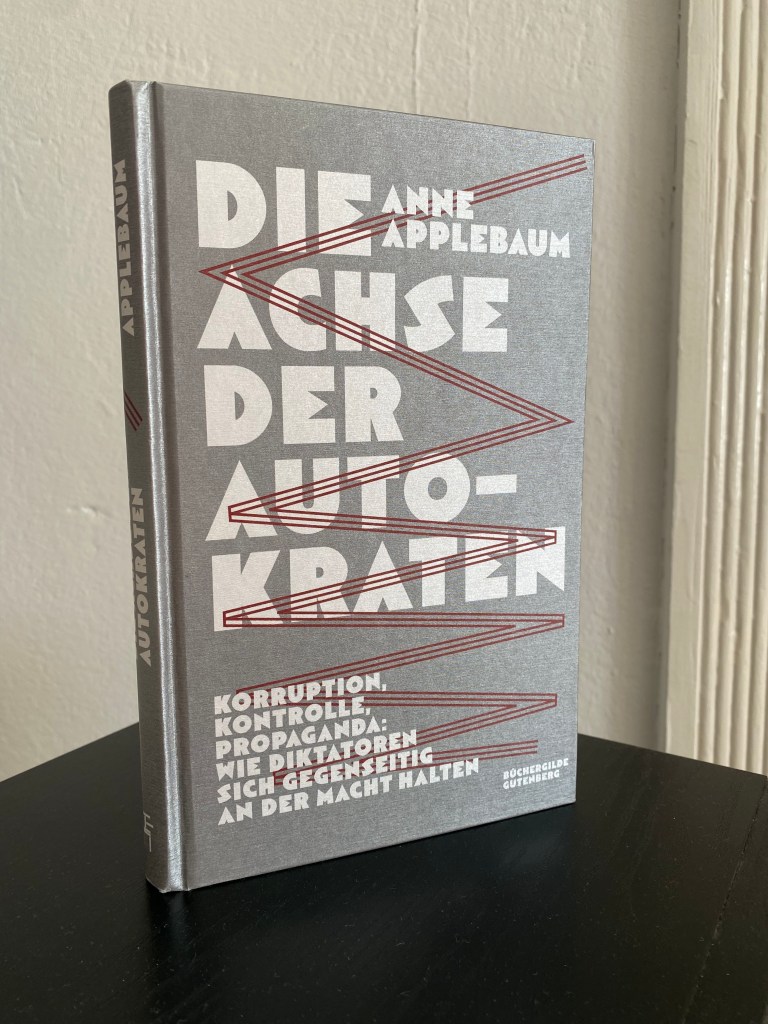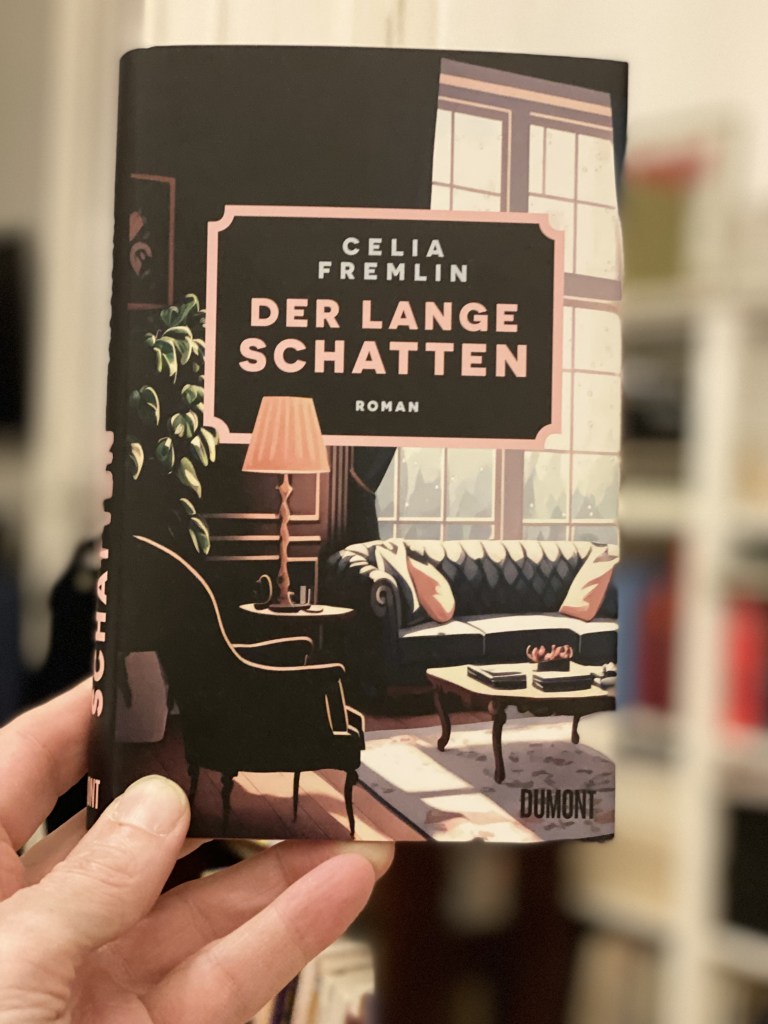Harald Jähner, Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen, 2022, Tb. 2024, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 556 Seiten

Noch ein Buch über die Weimarer Republik? Ja. Denn Harald Jähner verfolgt in Höhenrausch einen guten Ansatz. Natürlich erzählt er eine bekannte Geschichte, von der wir zudem wissen, wie sie ausgeht. Aber er versucht, dies aus der Perspektive der Zeitgenossen zu tun, die das eben nicht wissen, die Entwicklungen, Themen und Angebote aus der jeweiligen Zeit heraus einschätzen, beurteilen, annehmen oder verwerfen. Dieser Ansatz macht ebenso den Reiz des Buches aus wie seine breite Themenpalette.
Beim Schreiten durch die Jahre der Weimarer Republik beschränkt sich Jähner nicht auf die politische Geschichte Deutschlands, sondern wirft immer wieder einen genauen Blick auf die Kultur- und Sozialgeschichte des Deutschen Reichs. Es geht also um die Emanzipation und verstärkte Teilhabe beziehungsweise öffentliche Sichtbarkeit von Frauen, es geht um neue Freizeitbetätigungen, um einen gewandelten Kulturbegriff, um neue Körperlichkeit, usw.
Das Buch vermittelt einen sehr guten Eindruck von der Zeit, es beruht auf einer breiten, sorgfältig recherchierten und ausgewerteten Quellenbasis und stellt für jedermann eine lohnende Lektüre dar. Auch demjenigen, der über die Zeitläufte gut Bescheid weiß, wird das eine oder andere neue Datei nahe gebracht. Der frische Blick ist in jedem Fall die Lektüre wert.
Vierzehn Kapitel werden von Pro- und Epilog gerahmt. Der Prolog reißt sofort die Gegensätze auf, die die damalige Diskussion beherrschen und die Menschen umtreiben: Umbruch und Bewahrung, Masse und Individuum, Pluralismus oder Volksgenossenschaft. Im Epilog widmet Jähner einzelnen Personen, die im Buch erwähnt worden waren, jeweils einen Absatz. Die Schicksale sind vielfältig: Flucht und Exil, KZ und Totschlag, Über- und Weiterleben in Ost oder West.
Dazwischen passiert unheimlich viel: Demobilisierung, Republik, Gewalt, neue Arbeitswelt, neue Kleidung, neue Architektur, Kultur und Subkultur, Krise und Aufschwung, Risiko und Chance, Depression und Massenarbeitslosigkeit, Terror und Verführung, Intrige und Profitdenken.
Eine klare Leseempfehlung für dieses Buch, das klassische Geschichtsdarstelliungen sinnvoll ergänzt.